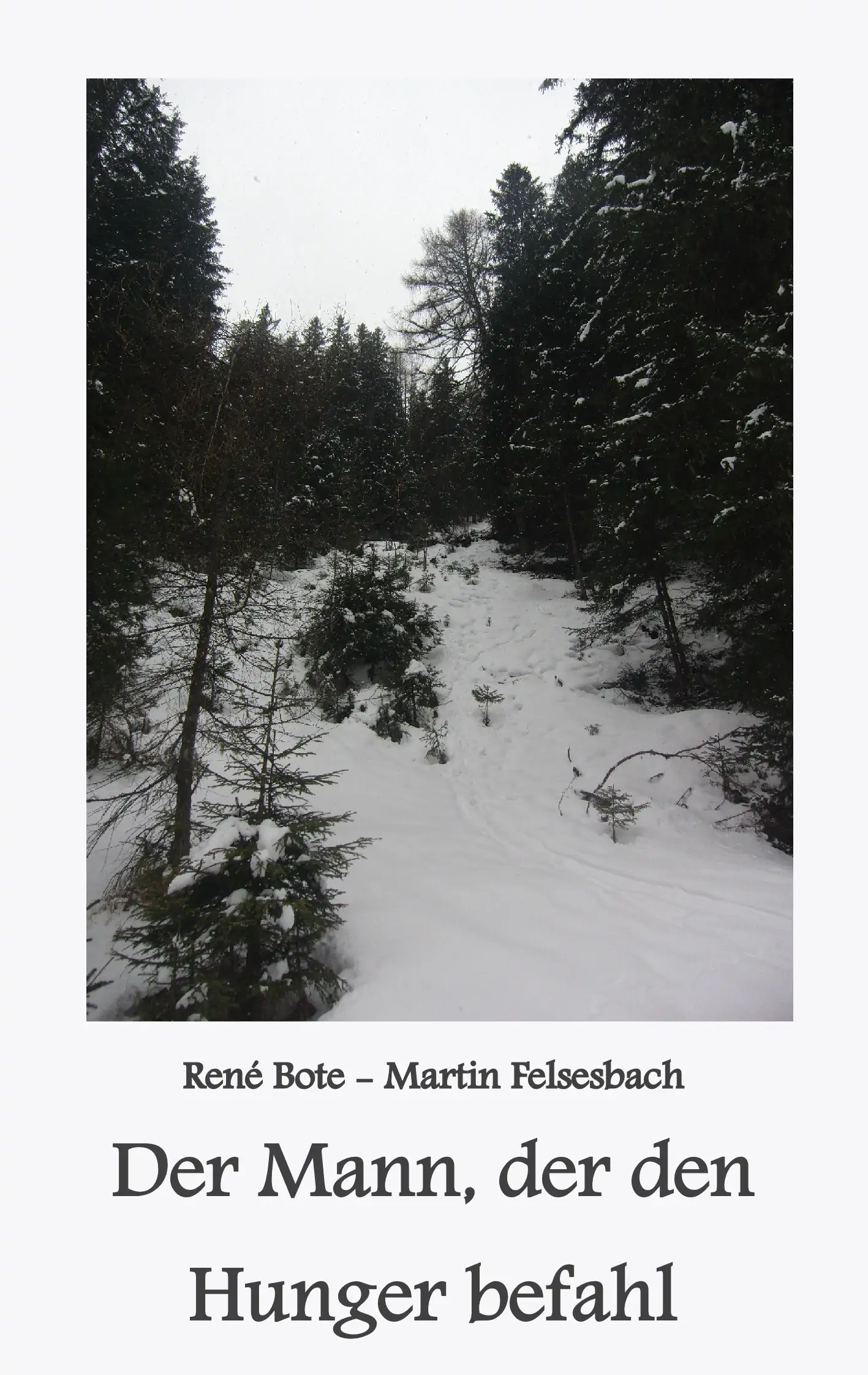


 4. April 2016
4. April 2016
 152
152
 978-3837076318
978-3837076318
 Books on Demand
Books on Demand
Als der Winter kein Ende nehmen will, befiehlt Barn, der Oberste des Dorfes, dass nur noch die zu essen bekommen sollen, die arbeiten können. Es ist das Todesurteil für die Alten und Kranken, und auch für seinen eigenen Sohn, denn Jore ist blind. Zum Glück hält Meira zu Jore, seine einzige Freundin, und teilt ihre kargen Rationen mit ihm, aber das wenige Essen, das Meira zugeteilt wird, reicht nicht für zwei. Meira wird selbst immer schwächer, bald wird sich nicht mehr arbeiten können und selbst keine Rationen mehr bekommen, und dann wären sie beide verloren. Jetzt gibt es nur noch einen, der die Macht hat, ihnen zu helfen, doch von diesem einen wusste noch nie jemand etwas Freundliches zu berichten…

Was kommt dabei heraus, wenn sich ein Jugendbuchautor und ein langjähriger Fantasy-Rollenspieler und Spielleiter zusammentun? Genau – ein Jugendfantasybuch. Die Story zu Der Mann, der den Hunger befahl entstand in Zusammenarbeit mit Martin Felsesbach, der seit über fünfzehn Jahren regelmäßig Rollenspielrunden leitet und die Geschichten dafür selbst erstellt. Martin hat schon des öfteren seinen Rat zu meinen Geschichten beigesteuert, so wie ich umgekehrt die eine oder andere Idee für seine Rollenspiele, so dass der Gedanke, gemeinsam ein Buch zu schreiben, eigentlich nahe lag.
Das Dorf am Rand des Waldes kannte außer den Menschen, die dort lebten, fast niemand. Es brauchte nicht einmal einen Namen, war einfach nur das Dorf, denn kaum ein Fremder verirrte sich je in diesen abgelegenen Landstrich. Selbst für reisende Händler, die fast überall herumkamen, wo Menschen lebten, lohnten die wenigen Geschäfte, die sie hier machen konnten, kaum den langen Weg. In manchen Jahren waren die Abgesandten des Königs, die im Herbst, wenn die oft magere Ernte aus Obst, Gemüse und Getreide eingebracht war, kamen, um den Zehnten einzufordern, die einzigen Besucher.
Barn, dem der größte Hof gehörte, war der unangefochtene Anführer, lenkte die Geschicke des Dorfs und hielt Gericht, selbst bei schweren Verbrechen, über die zu urteilen einem vom König eingesetzten Richter vorbehalten gewesen wäre. Die Stadt des Königs war weit, es waren etliche gefährliche Tagesreisen dorthin, und das Dorf war viel zu unwichtig für den König, um jemanden dorthin zu entsenden außer den Eintreibern, die ihm den Zehnten brachten.
Wer krank war oder einen Unfall erlitten hatte, ging zu Chorm, dem Heiler, wer Werkzeug oder eine Waffe brauchte, wandte sich an Bere, den wuchtigen Schmied, dem auch die kleine Mine gehörte, aus der das Erz kam. Sjorne, der Wirt, vergor Honig zu Met, der in seinem Gasthaus ausgeschenkt wurde. Er hatte auch zwei Schlafgemächer für Gäste, aber niemand konnte sich an den letzten Gast entsinnen, der dort übernachtet hatte.
Die meisten Menschen im Dorf lebten von Ackerbau und hielten Schafe, Ziegen und Geflügel. Wenn die Ernte gut war, dann hatten die Familien ihr Auskommen, aber wenn der Sommer zu nass oder aber zu trocken gewesen war, was nicht zu selten vorkam, dann wurde im Winter die Nahrung knapp. Oft mussten Rinde und Wurzeln den kargen Speiseplan ergänzen.
Jeder musste seinen Teil zum Auskommen der Familie beitragen, das fing bei den Kindern an, sobald sie alt genug waren für einfache Tätigkeiten, und ging bis hin zu den Alten, solange sie noch dazu in der Lage waren. Schon mit drei oder vier Jahren halfen die Kleinen ihren Großmüttern beim Spinnen und hielten die Wolle auseinander, kräftige Kinder begannen mit fünf oder sechs Jahren, in Beres Mine zu arbeiten und Erz und Abraum auf einfach Holzschlitten aus den engen Gängen zu ziehen. Spätestens mit dreizehn oder vierzehn Jahren, wenn sie zu groß waren für die niedrigen Stollen, wechselten sie zur Feldarbeit oder ließen sich in ein Handwerk einweisen.
Barn wachte gestreng darüber, dass niemand, der in der Lage war, zu arbeiten, sich der Arbeit entzog, und teilte die Tagelöhner zu, die keinen eigenen Hof hatten oder einen, der so klein war, dass er sie und ihre Familien nicht zu ernähren vermochte. Sein Wort war Gesetz, und niemand zog seine Entscheidungen in Zweifel.
Er war der letzte, der sich Sorgen machen musste, ob das Essen über den Winter reichte, und hätte ein glücklicher Mann sein können, aber noch fehlte ihm etwas dazu: Ein Stammhalter. Seine Frau Vemara hatte ihm sechs Kinder geboren, doch der erste Sohn, Jore geheißen und mit Stolz gehütet, war in seinem ersten Winter am Fieber gestorben, und der zweite, geboren nach und vor zwei Schwestern, war blind. Barn hätte den Jungen im Gebirge ausgesetzt, damit er verhungerte, doch Vemara hatte ihn bekniet, es nicht zu tun, und so duldete Barn widerwillig den Sohn, der den Namen bekommen hatte, den auch sein verstorbener Bruder getragen hatte.
Weil er weder in der Mine, noch auf dem Feld arbeiten, noch Vieh hüten oder ein Handwerk erlernen konnte, musste Jore jene Arbeiten verrichten, die sonst den Alten, Hochschwangeren und Stillenden überlassen blieben. Im Hinterzimmer des Bauernhauses saß er neben seiner Großmutter und spann Wolle zu Garn, mahlte Getreide zu Mehl und flickte, nur auf das Gespür der Finger angewiesen, die Kleidung der Familie. Über die Jahre war er immer geschickter dabei geworden, und selbst sein Vater musste widerwillig zugeben, dass Jore die Wolle genauso schnell spann, das Mehl genauso fein mahlte und die Kleidung genauso sauber flickte wie seine Großmutter. Trotzdem verachtete er seinen einzigen Sohn und vermied es, mit ihm zu sprechen. Obwohl ihm Mädchen nicht viel galten, zog er die Töchter vor, Belia, Marje und Sisja, vor allem aber Stene, die älteste, die einmal eine schöne und begehrenswerte Frau zu werden versprach. Sie hatte etliche Verehrer unter den jungen Männern im Dorf, die voller Neid Fledjor, beobachteten, den Sohn des Bauern Goam, der es geschafft hatte, ihre Gunst zu gewinnen. Nur die einzige Tochter des Schmieds, die ebenfalls hübsch und klug war, war ähnlich begehrt.
Sooft er konnte, entfloh Jore seinem unfreundlichen Zuhause, dessen Kälte die Mutter nur unzureichend lindern konnte. Zusammen mit seiner einzigen Freundin durchstreifte er dann die Wälder, die das Dorf umgaben. Meira, seine ständige Begleiterin, war im gleichen Winter geboren wie Jore und im Dorf nicht besser gelitten als er. Zwar war sie völlig gesund, arbeitete so hart in der Mine und auf den Feldern wie alle anderen Kinder auch und hatte sich nie etwas zuschulden kommen lassen, aber ihr feuerrotes Haar und ihre funkelnden grünen Augen in einem Gesicht voller Sommersprossen machten den Menschen Angst. Obwohl Meira sanft und hilfsbereit war, glaubten die Leute, dass etwas Böses in ihr wohnen müsste, etwas, das auf sie übergreifen würde, wenn sie ihr zu nahe kamen. Die Eltern verboten ihren Kindern, mit ihr zu spielen, und niemand half ihr, Steine vom Feld zu schleppen oder Rüben auszugraben, aus Angst, Meira könnte es ihnen mit Unglück vergelten.
Jore wusste, was über Meira gesprochen wurde, und er wusste, dass sie anders aussah als die anderen, auch wenn er sich weder vorstellen konnte, wie sie, noch wie die anderen aussahen. Doch er sah mit dem Herzen, und er spürte mit untrüglicher Sicherheit, dass Meira ein guter Mensch war, eine treue Gefährtin, auf die er sich zu jeder Zeit verlassen konnte. Ihr konnte er Geheimnisse anvertrauen, die er mit niemand anderem teilen konnte, bei ihr fand er Trost, wenn die Verachtung des Vaters ihn traf, und auf ihre Führung konnte er sich im unwegsamen Wald verlassen.
Vieles, was er konnte, verdankte er nur ihr. Mit unendlich viel Geduld und voller Glauben daran, dass er es konnte, auch ohne zu sehen, übte Meira mit ihm und führte seine Hand, bis er die Griffe beherrschen gelernt hatte. Dank ihrer Hilfe konnte Jore schwimmen, im Fluss angeln und einen Bogen bauen, und sie hatte ihm auch beigebracht, eine Flöte zu schnitzen und Melodien darauf zu spielen. Wann immer sie konnte, lauschte sie dem Klang der Flöte, und Jore erdachte neue Melodien nur für sie, die kein anderer je zu hören bekam.